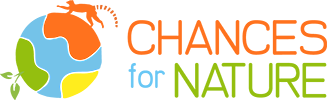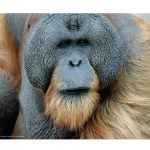Geier haben ein Imageproblem. Viele Menschen mögen sie nicht wegen ihrer kahlen Hälse und weil sie immer dort auftauchen, wo der Tod lauert. Dabei handelt es sich um extrem nützliche Vögel. Sie töten nicht selber, sondern verwerten das Aas verstorbener Tiere und sind damit eine elementar wichtige Gesundheitspolizei. Ohne sie droht der Ausbruch von Seuchen. Aber kümmern wir uns speziell um die Geschichte des Weißrückengeiers.
Grundsätzlich findet man Weißrückengeier in Afrika südlich der Sahara. Mit 2,25 m Flügelspannweite und einem Gewicht bis 7 kg sind sie schwer zu übersehen. Durch die namensgebenden weißen Federn am Rücken kann man sie leicht von anderen Geierarten auseinanderhalten. Die Schnabelspitze, ist dafür geeignet, den toten Körper zu öffnen. Der Hals ist frei von Federn, damit sie tiefer in den Kadaver vordringen können, ohne sich mit dem Blut das Gefieder zu verkleben.
Weißrückengeier arbeiten sozial. Man kann sie oft in größerer Anzahl antreffen. Haben sie Kadaver gefunden, betreiben sie oft Arbeitsteilung. Einige Tiere halten den toten Körper in Position, damit andere ihn besser aufreißen können. Durch ihre Übersicht aus der Luft sind sie oft die Ersten, die bei einem Kadaver eintreffen und sorgen so für eine Entsorgung potentieller Gefahrenquellen. Durch ihre ungemein starke Magensäure sind sie selbst immun gegen Krankheiten wie Milzbrand oder Tollwut.
Kurzum, Geier sind perfekte und ungemein nützliche Tiere. Aber warum sind sie dann so gefährdet? Zum einen liegt das an der Zerstörung des Lebensraums der Tiere. Die Urbanisierung schreitet voran, mit ihr der Bedarf für Lebensmittel. Dadurch wird Natur in Bau- und Farmland gewandelt, so dass weniger Fläche für die Tierwelt vorhanden ist. Entsprechend weniger Kadaver fallen an für die Weißrückeneier, die durch die Zerstückelung der Lebensräume auch weitere Strecken zu fliegen haben. Womit die Tiere nicht klarkommen, sind die Nebenwirkungen der Besiedelungen, zum Beispiel die Stromleitungen – an ihnen erleiden sie einen tödlichen Stromschlag. Die größere Gefahr für Geier sind aber Vergiftungen. Farmer versuchen ihre Tiere zu schützen, indem sie ein vergiftetes Tier auslegen in der Hoffnung, dass Beutegreifer dort zuschlagen und am Gift sterben. Damit wird nicht auf die Greifvögel abgezielt, aber da sie oft als Erstes vor Ort sind, nehmen sie das Gift als Erste auf – und da sie in einer Gruppe arbeiten, stirbt nicht nur ein einzelnes Tier daran. Mit ähnlichen Methoden gehen Wilderer vor, die entweder Tiere für den illegalen Wildtierhandel fangen wollen, oder aber mit dem vergifteten Kadaver vor einer anderen Tötung ablenken wollen, auf die Geier die Ranger aufmerksam machen würden. Während Geier im Gegensatz zum Menschen nichts bei Tollwut und Milzbrand befürchten müssen, ist das für die Tiere tödliche Mittel für die Menschen ein Positives: Diclofenac lindert bei uns die Schmerzen, während die Greifvögel es nicht überleben.
Hilfe für die Weißrückengeier sowie andere Tiere besteht im Ausweisen von Wildtierschutzgebieten, wo Menschen erschwerten Zugang zu besitzen. Zudem gilt es, die Bevölkerung und im Speziellen die Farmer überhaupt von der Nützlichkeit der Tiere zu überzeugen – eine mühsame und langwierige Aufgabe. Anfang der 90er schätzte man den Bestand an Weißrückengeiern noch auf 270.000 Tiere, mittlerweile sind es 80% weniger.
ARTENPROFIL
| Art: | Weißrückengeier |
| Unterart: | – |
| Wissenschaftl. Name | Gyps africanus |
| Vorkommen: | Afrika südlich der Sahara |
| IUCN Status: | vom Aussterben bedroht |
| Nachwuchs: | 1-3 (meist 1) Eier, einmal jährlich, 2 Monate Brutzeit, Nistzeit 4-5 Monate |
| Ernährung: | Aas |
| Feinde: | Menschen |
| Lebenserwartung: | ca 20 Jahre |