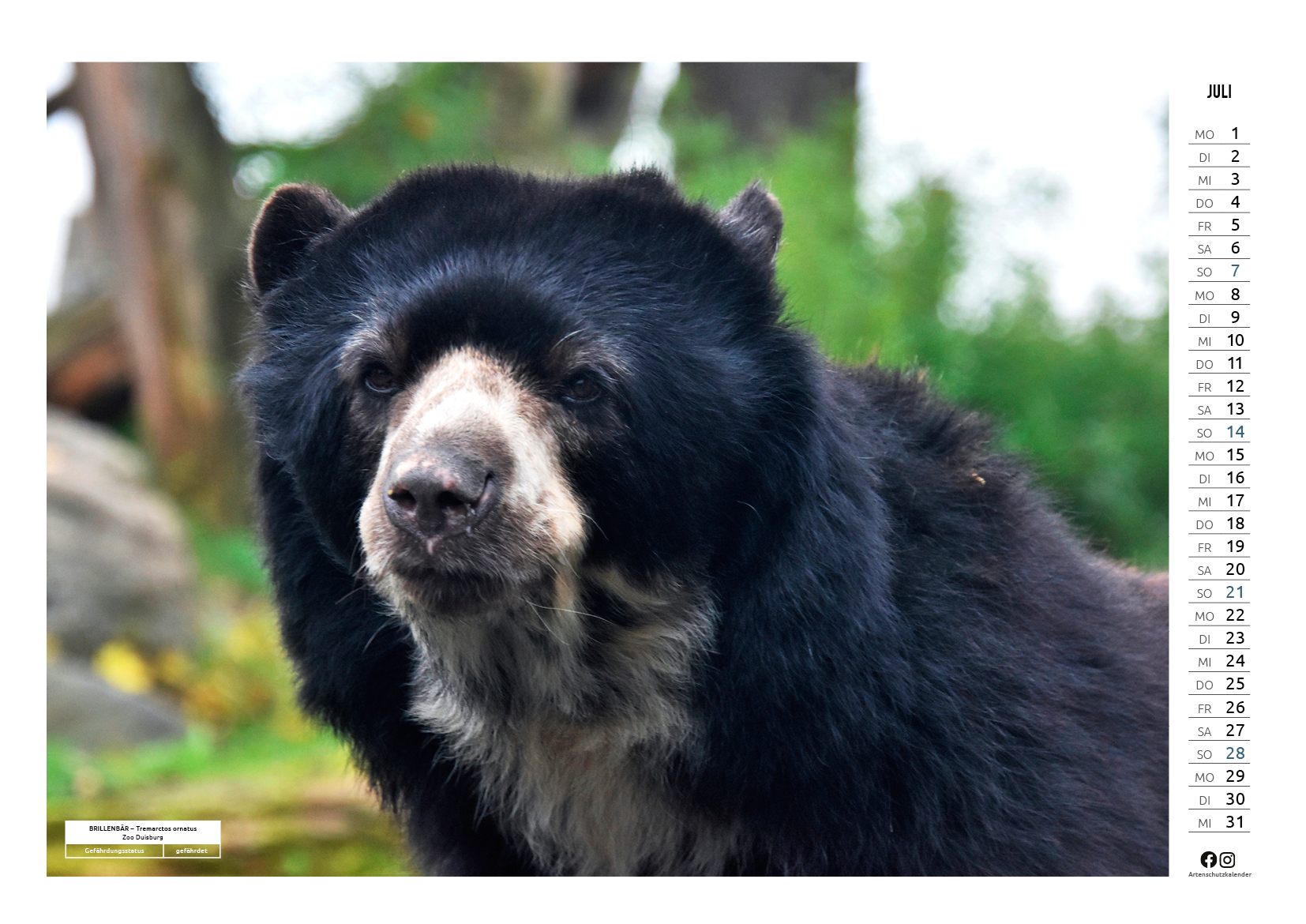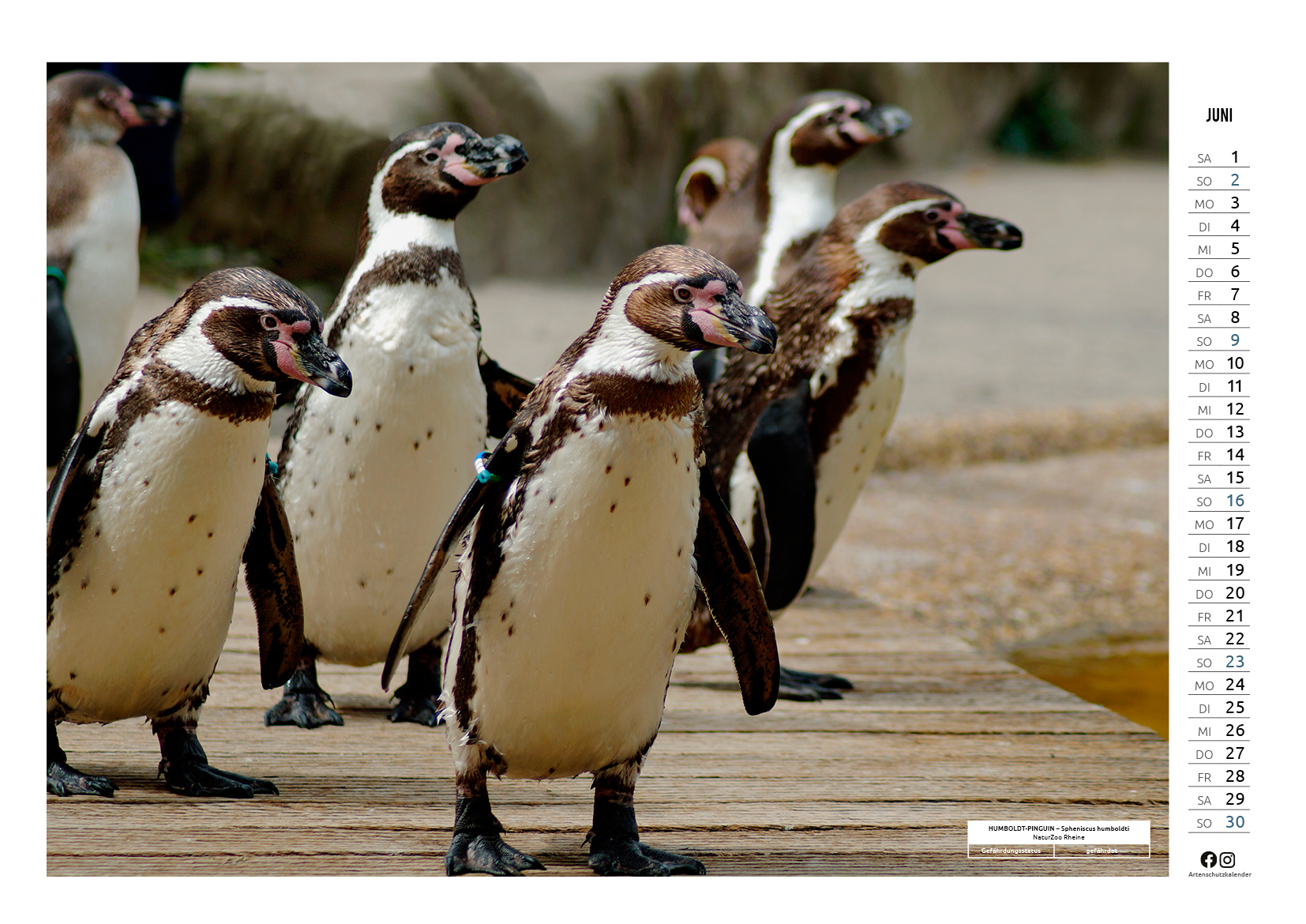Vorweg aus aktuellem Anlass: die Waldbrände haben in diesem Jahr wieder gewütet und den Ort Jasper in Teilen zerstört. Aktuell ist die Stadt nicht zugänglich wie auch der Jasper Nationalpark gesperrt ist. Eine kurzfristige Hilfe ist dieser Bericht daher nicht!
Der Jasper Nationalpark liegt direkt nördlich vom Banff Nationalpark und geht fließend ineinander über. Auch dieser Nationalpark zählt zum Unesco Welterbe. Mit knapp unter 11.000 km² Größe ist er nochmal ein ganzes Stück größer als der südliche Nachbar. Die Gründung des Parks war 1907. Heute kommen 2,5 Millionen Besucher in diesen Park, also schon deutlich weniger als in den Banff Nationalpark – wenngleich er damit immer noch der Nationalpark mit den zweitmeisten Besuchern in Kanada ist. Durch die größere Entfernung von der menschlichen Zivilisation kann man hier noch deutlich besser die Tierwelt finden. Je weiter man in den Norden fährt, desto weniger Besucher hat man zu erwarten. Auch der 5.000 Einwohner zählende namensgebende Ort Jasper ist zwar touristisches Zentrum, aber bei Weitem nicht so überlaufen wie Banff.
Wenn man den Icefields Parkway von Banff kommend befährt, erreicht man schnell das Columbia Icefield. Hier ist es noch sehr touristisch, ein sehr großer Parkplatz und ein Besucherzentrum laden zu geführten Fahrten in den Gletscher ein. Auch ein gläserner Skywalk über dem Abgrund bietet Menschen ohne Höhenangst ein Abenteuer von dieser Stelle aus. Wasserfälle wie die Sunwapta Falls oder die Athabasca Falls finden sich unweit der Strecke. Ein Stop empfiehlt sich am Goats and Glacier Lookout. Mit etwas Glück findet man am Steilhang Schneeziegen, die hier am salzigen Gestein ihren Mineralhaushalt auffüllen.
Unweit von Jasper geht es ab in die Maligne Lake Road, wo es am Medicine Lake vorbei zum Maligne Lake geht. Die Chance auf Tiersichtungen ist an dieser Straße besonders groß. Auf dem Maligne Lake fahren in den Sommermonaten auch Boote, hier gibt es noch mal ein höheres Touristenaufkommen.
Der Jasper Nationalpark verläuft noch deutlich weiter nach Norden, die meisten werden hier jedoch den Highway 16 nehmen und Richtung Hinton den Park verlassen. Etwa 370 km östlich von Jasper erreicht man Edmonton, die Hauptstadt der Provinz Alberta.