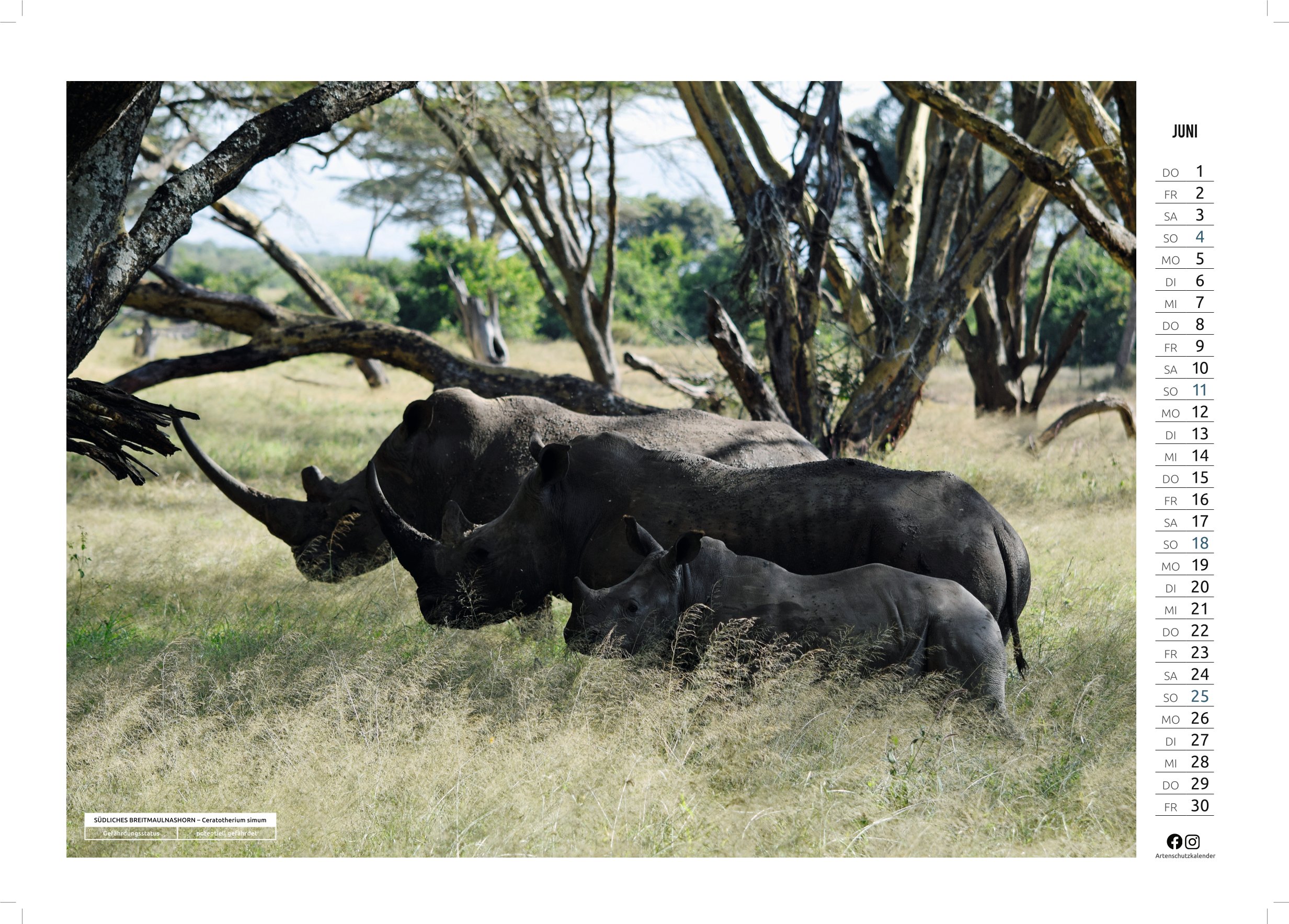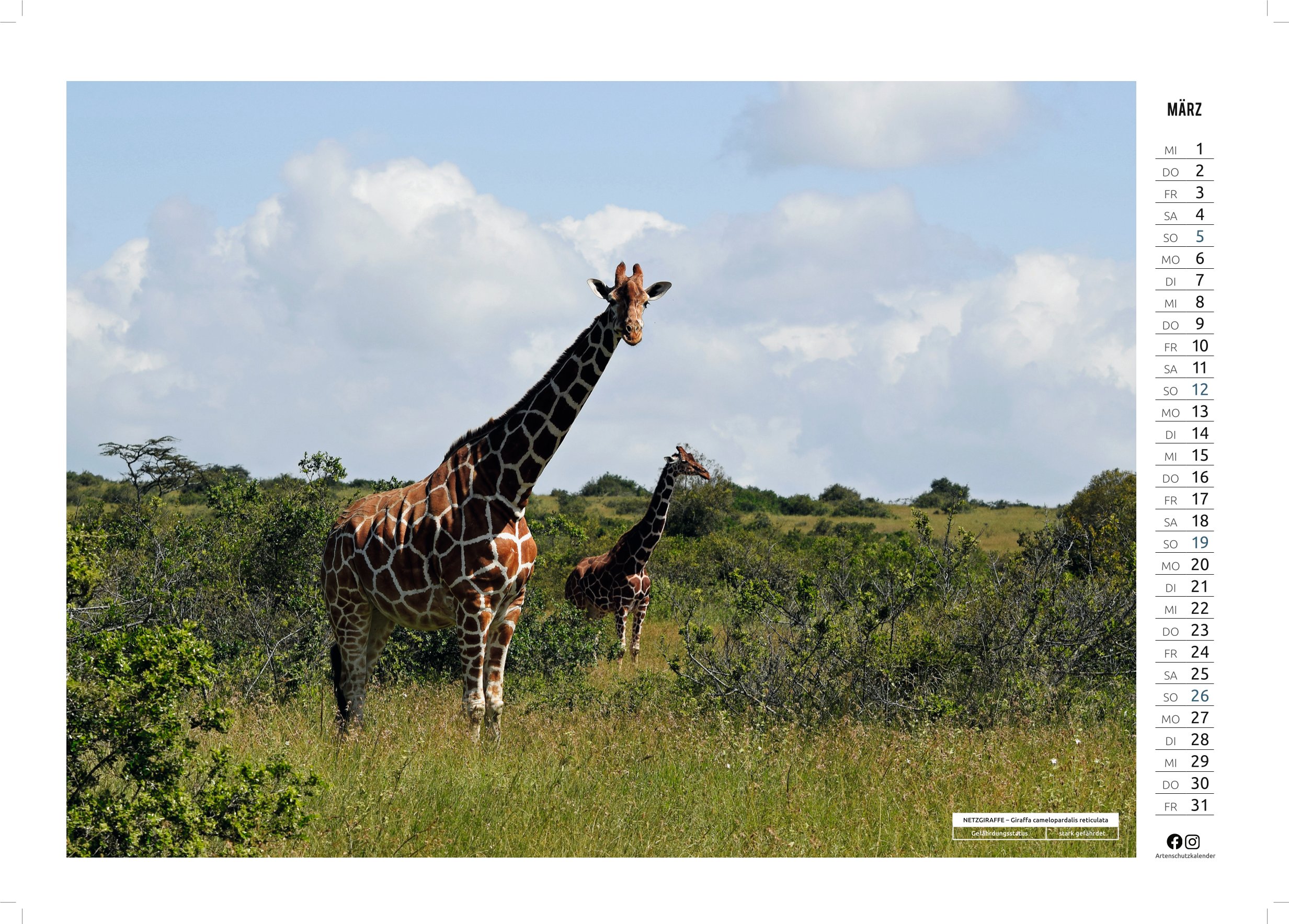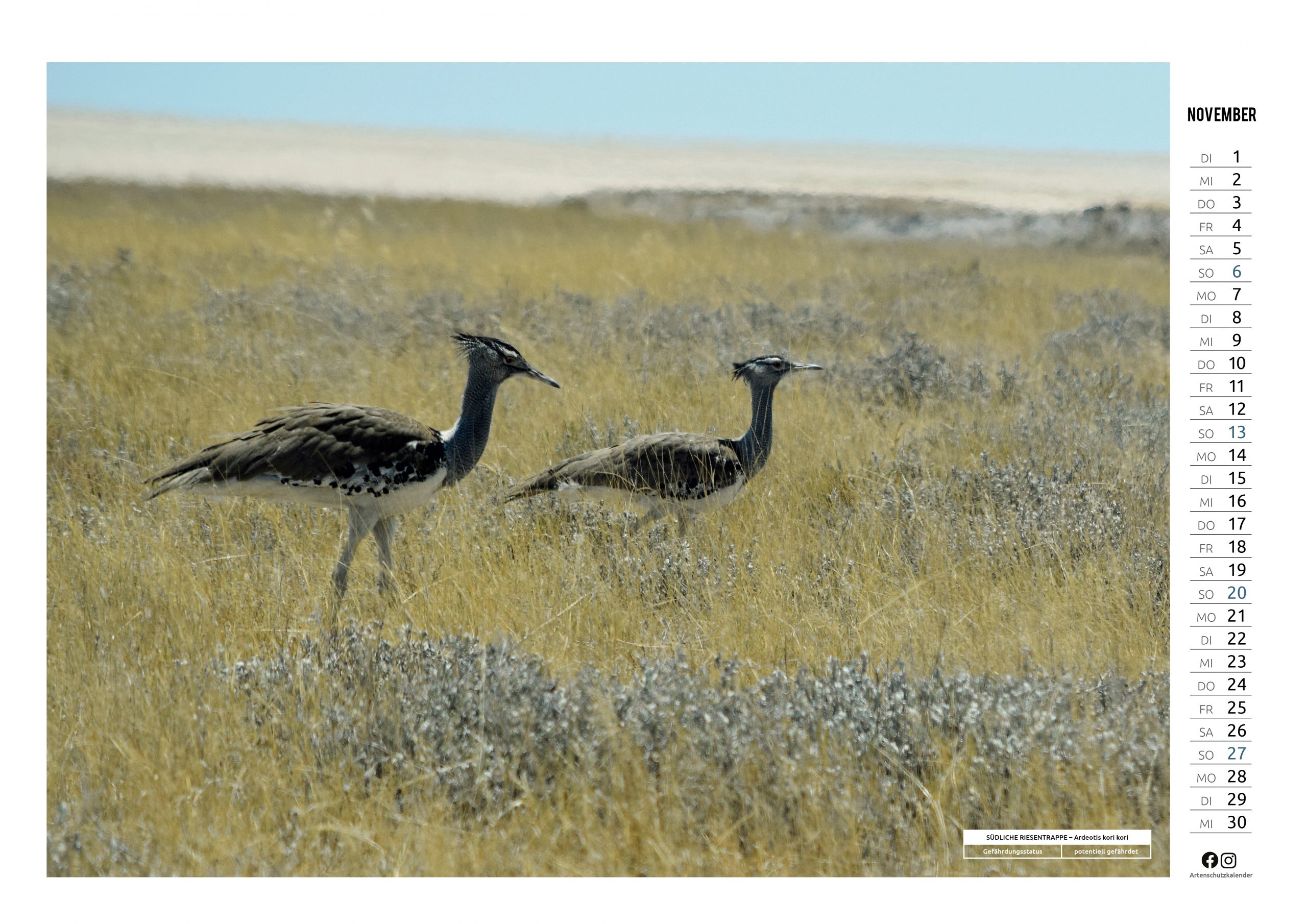Pinguine kennt jedes Kind als weiß-schwarze flugunfähige Vögel, die an Land lustig watscheln und dafür im Wasser umso geschickter sind. Sie kommen alle mit Ausnahme des Galapagos-Pinguins nur auf der Südhalbkugel vor, allerdings ist es nach wie vor ein weit verbreiteter Irrglaube, dass sie alle in Schnee und Eis beheimatet sind. Wohl aber kann man sie nur in Gegenden antreffen, wo Kaltwasserströme vorhanden sind – so etwa in Süd-Australien, Südafrika, Namibia oder an der Westküste Südamerikas hoch bis nach Galapagos. Insgesamt existieren 18 Pinguinarten, deren Größe von 30 Zentimetern bei kleinen Exemplaren des Zwergpinguins bis 1,20 m beim Kaiserpinguin variiert.
Um den oftmals extremen Wetterbedingungen etwas entgegenzusetzen, verfügen die Pinguine über eine Fettschicht, über der sich noch wasserdichte Federlagen befinden. Arten, die in wärmeren Regionen leben, haben nicht gefiederte Partien im Gesicht, über die Wärme wieder abgegeben werden kann. Kurz nach Ende der Brutzeit mausern die Vögel. Als Nahrung dienen den meisten Arten Fische, einige ernähren sich von kleinen Krebstieren. Den Wasserbedarf decken Pinguine mit Meerwasser ab, wobei sie das Salz durch spezielle Drüsen über den Augen wieder ausscheiden.
Pinguine sind Meeresbewohner, die nur zum Brüten und während der Mauser das Land aufsuchen. Im Wasser sind die Tauchleistungen der Arten sehr unterschiedlich. Manche leben knapp unter der Wasseroberfläche und tauchen nicht unter 20 Metern, während die größeren antarktischen Arten auch über 500 Meter tief tauchen können. An Land sind Pinguine kurzsichtig, da ihre Sicht auf Unterwasserverhältnisse ausgerichtet ist. Die Tiere verfügen über kleine, kaum sichtbare Ohren, die geschlossen werden können, um keinen Druckschaden unter Wasser zu erleiden.
Grundsätzlich sind Pinguine sehr gesellige Vögel. Je nach Art unterscheidet sich die Treue zwischen den Paaren. Wenn gemeinsam Nachwuchs großgezogen wurde, ist in jedem Fall die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die beiden Protagonisten im Folgejahr wieder zusammenfinden. Kaiser- und Königspinguine legen nur ein Ei, alle anderen Arten zwei Eier. Das Erstgeborene wird bei vielen Arten bevorzugt, evolutionäres Ziel ist das Aufbringen eines Jungtiers, wodurch das zweite Ei meist der Absicherung dient falls der erste Nachwuchs früh verstirbt. Je höher das Nahrungsangebot ist, desto wahrscheinlicher ist, dass beide Küken überleben. In den ersten Wochen nach dem Schlupf verbleibt ein Elternteil beim Nachwuchs, der Partner geht auf Nahrungssuche. Wenn der Nachwuchs größer ist, verbleiben sie mit anderen Küken zusammen, während die Eltern beide Futter beschaffen. Wenn die Eltern ihre Mauser beendet haben und ins Wasser zurückkehren, ist auch die Aufzucht des Nachwuchses beendet.
An Land haben Pinguine kaum Feinde, allenfalls Füchse – und Hauskatzen sowie Hunde in Gebieten, wo Menschen leben. Im Wasser sind es Robben, Wale und Haie, die oft im flachen Wasser auflauern – dies ist auch der Grund, warum Pinguine so vorsichtig ins Wasser gehen. Wenn das Gewässer tief ist, sind die flugunfähigen Vögel wegen ihrer Wendigkeit nur schwer zu fangen. Zehn der achtzehn Pinguinarten gelten als gefährdet mit unterschiedlichen Bedrohungsstufen. Tendenziell sind die antarktischen Arten sicherer, weil sie wegen ihrer abgeschiedenen Lage weniger menschlichen Einflüssen ausgesetzt sind.